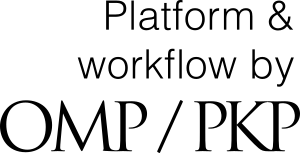Fortschritt und Verfall: Zur Diskussion von Religion und Moderne im Ausgang von Joachim Ritter
Schlagwörter:
Religion, Religionstheorie, Geschichte nach 1945, Modernität, Nachkriegsdeutschland, PolitikÜber dieses Buch
Mit dem gewachsenen Interesse für die Geistesgeschichte Nachkriegsdeutschlands und der Bundesrepublik hat auch der Name Joachim Ritter in den letzten Jahren verstärkt Beachtung gefunden. Zwischen 1946 und 1968 lehrte er Philosophie an der Universität Münster und beeinflusste als akademischer Lehrer durch sein Collegium Philosophicum eine ganze Reihe von namhaften Hochschullehrern und Intellektuellen. Diese Studie rekonstruiert zum einen die Entwicklung dieses Kreises. Insbesondere untersucht sie, wie Joachim Ritters Philosophie, sein Verständnis der modernen Welt und seine eigene intellektuelle Entwicklung in den Nachkriegsjahren bei seinen akademischen Schülern wirksam wurden, namentlich bei Hermann Lübbe und Odo Marquard, Robert Spaemann und Ernst-Wolfgang Böckenförde. Besonderes Augenmerk gilt zum anderen den religionstheoretischen und -politischen Überlegungen dieser Autoren, die sich, obwohl jeweils entscheidend von Ritter beeinflusst, doch deutlich voneinander abheben. Zur Erschließung dieser unterschiedlichen Perspektiven auf Moderne und Religion im Kontext der jungen Bundesrepublik – zwischen Fortschritt und Verfall – werden Bezüge zu Autoren wie Carl Schmitt und Hans Blumenberg aufgegriffen und nachgelassene Aufzeichnungen Joachim Ritters ausgewertet. Durch ihre offenen Anschlusspunkte ebenso wie durch ihre inhaltlichen Ambivalenzen, die zudem im zeitlichen Verlauf nicht unverändert blieben, erweist sich rückblickend die Fruchtbarkeit, mit der Ritters Philosophie die Auseinandersetzung mit der eigenen Gegenwart anzuregen vermochte, als sein maßgebliches Erbe.
Lesen Sie hier die detaillierte English Summary: http://bit.ly/1RwKDGJ